Wrocław - Die Europäische Kulturhauptstadt für Achtung und Toleranz

Wrocław (Breslau) ist Europäische Kulturhauptstadt 2016. Mit der Benennung von Kulturhauptstädten verfolgt die Europäische Union seit 1985 das Ziel, Reichtum, Vielfalt und die Gemeinsamkeiten des kulturellen Erbes in Europa aufzuzeigen. Die neue polnische Regierung geht auf Distanz zu Europa. In dieser Spannung zeigt sich die Einzigartigkeit Wrocławs in Europa deutlicher denn je. Neben seiner historischen Bedeutung fällt ein Projekt der jüngeren Geschichte besonders auf.
Das Viertel der gegenseitigen Achtung
Etwas abseits der touristischen Sehenswürdigkeiten der Altstadt findet man eine Evangelische Kirche, eine griechisch-katholischen Kirche, eine Synagoge und eine katholische Kirche. Die drei Kirchen befinden sich zusammen mit der 2010 wieder eröffneten Synagoge im ehemaligen jüdischen Viertel der Stadt. Äußeres Zeichen der Gemeinsamkeit der doch recht unterschiedlichen christlichen Konfessionen und des jüdischen Tempels, ist ein Schild, auf dem man die Symbole der vier Glaubensgemeinschaften sieht.

Die Polnisch-Orthodoxe Kirche hat eine konfliktreiche Geschichte hinter sich. In der ehemaligen Sowjetunion versuchte man die Zwangsvereinigung mit der russisch orthodoxen Kirche. In Wrocław ist sie heute religiöses Zentrum von Ukrainern, die bis zum Krieg im Südosten des Landes lebten. 1947 wurden sie auf Beschluss der kommunistischen polnischen Führung nach West- und Nordpolen deportiert. Noch heute sind die Gläubigen von den leidvollen Erfahrungen der Vertreibung geprägt.

Die Synagoge "Zum Weißen Storch" wurde 1829 ihrer Bestimmung übergeben. Die Pogromnacht überstand das klassizistische Gebäude unbeschadet. Aber wenig später mißbrauchte man sie als Garage und Lager für geraubtes jüdisches Eigentum. Im Nachkriegspolen wurden Studentenunruhen genutzt um erneut gegen Juden vorzugehen. Eine staatlich unterstützte antisemitische Kampagne versuchte von der Kritik an der Regierung abzulenken. In den Jahren 1968 bis 1970 sahen 25.000 Juden den einzigen Ausweg in der Emigration. 1989 lebten nur noch einige tausend Juden in Polen. Aber mit der Wende 1989 gab es neue Hoffnung. Mit vielfältiger Unterstützung wurde die Synagoge im Jahr 2010 wieder eröffnet. Beim Rundgang empfängt den Besucher eine angenehme Athmosphäre. Im Hof Geklapper und Gemurmel von der Freiterasse des Cafes. Aus den geöffneten Toren der Synagoge lebensfroher Klezmer oder melancholische jiddische Musik - die Proben zu einem Konzert, das am Abend beginnt und längst ausverkauft ist. Die Synagoge beherbergt heute eine ergreifende Ausstellung. Diese führt vor Augen, welcher Reichtum seinerzeit durch jüdische Künstler, Wissenschaftler, Handwerker, Musiker und viele andere in die Welt hinaus ging.
Die katholische Kirche nimmt naturgemäß eine Sonderstellung ein. Als größte Kirche Polens die sogar einen Papst stellte, sind die Bemühungen nur schwach ausgeprägt, auf andere Konfessionen zuzugehen. Die aktuellen Entwicklungen hin zu einer größeren Staatsnähe rufen bei den kleineren Konfessionen Besorgnis hervor. Dennoch hatte der Stadtrat von Wrocław beschlossen, das Viertel der gegenseitigen Achtung in den Lehrplan der Schulen aufzunehmen. In einer Klassenstufe besuchen die Schüler jede der Kirchen und die Synagoge. Sie werden dort mit den Besonderheiten der Konfessionen und dem jüdischen Leben vertraut gemacht.
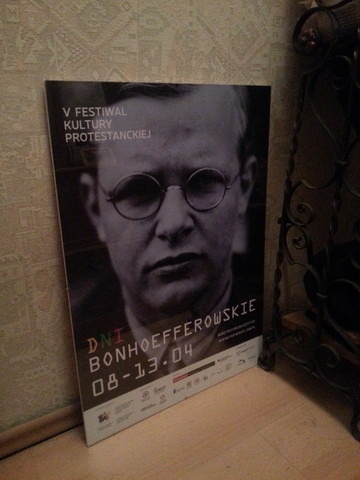

Aber gehen wir zurück ins Viertel der gegenseitigen Achtung. Die Geschichte des Projektes ist noch jung. 1995 ermunterte Jerzy Kichler, langjähriger Vorstand der jüdischen Gemeinde, die Mitarbeiter der Kirchen mit der Aufforderung "Machen wir was daraus". Die räumliche Nähe der Konfessionen und Religionen sollte auch einen Ausdruck im Gemeindeleben finden. "Wir haben uns zunächst kennengelernt", erklärt Witt. In monatlichen Begegnungen werden Vorurteile abgebaut, beginnt das Verstehen für die Positionen der Anderen. Konzerte und Vorträge folgen. Die Geschichte der Reformation, die Gemeinsamkeiten der Konfessionen und die jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens werden thematisiert. Und schließlich hat die Annäherung von Christen und Juden untereinander Auswirkung auf die ganze Stadt. Das Viertel wird in die Tourismusprogramme aufgenommen und erfährt weltweite Beachtung. Aber die Erfahrungen auf dem Weg von der anfänglichen Toleranz hin zur gegenseitigen Achtung machen auch sensibel für die gesellschaftlichen Entwicklungen. Schon im Sommer 2015 warnt Witt: "Polen ist gespalten". Umso wichtiger ist es, die Erfahrungen aus Wrocław zu bedenken. Witt drückt es so aus: "Er glaubt anders, aber Du sollst ihn achten!"
Hören Sie hier einen Audiobeitrag zum Thema (via PeerTube)